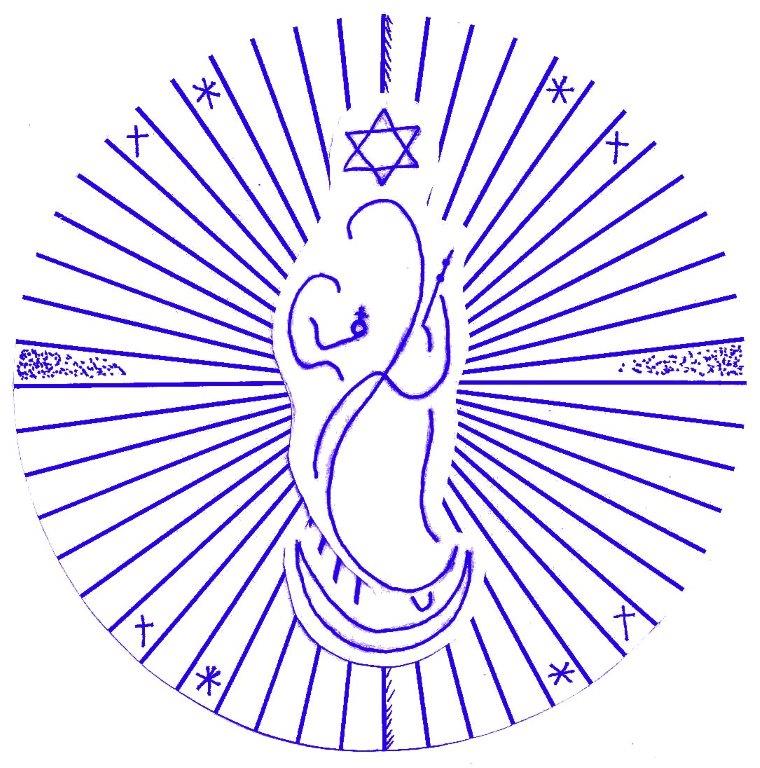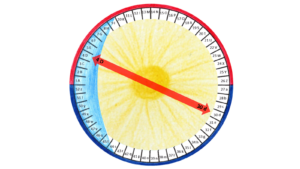
Die Gegensprüche 4 D und 30 d
| 4 D
Ich fühle Wesen meines Wesens: So spricht Empfindung, Die in der sonnerhellten Welt Mit Lichtesfluten sich vereint; Sie will dem Denken Zur Klarheit Wärme schenken Und Mensch und Welt In Einheit fest verbinden. |
30 d
Es sprießen mir im Seelensonnenlicht Des Denkens reife Früchte, In Selbstbewusstseins Sicherheit Verwandelt alles Fühlen sich. Empfinden kann ich freudevoll Des Herbstes Geisterwachen: Der Winter wird in mir Den Seelensommer wecken. |
Die Eurythmieformen zu den Mantren 4 D und 30 d
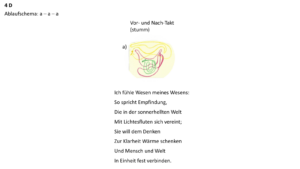

Über den Buchstaben “D”
Das D wird durch einen weichen Verschluss der Zunge hinter den Zähnen gebildet, der dann durch den stimmhaften Luftstrom gesprengt wird. Das D ist also ein Laut, der mit dem sanften Überwinden eines Widerstandes verbunden ist am Artikulationsort der Zähne.
Rudolf Steiner sagt über das D: “Wenn Sie jemand frägt, wo etwas ist, und Sie wissen es, so werden Sie die Gebärde des Hinweisens, die Sie machen, am ehesten mit dem Laut D begleiten. … Das D ist Hindeuten, Hinstrahlen. Die Nachahmung dieses Hindeutens, Hinstrahlens, das Aufmerksammachen, dass etwas da ist, liegt in dem D. … Und wenn Sie noch ausdrücken wollen, dass man über Ihr schnelles Informieren erstaunt sein soll, dann sagen Sie eben: da! Wenn Sie das Verwundern [das A] weglassen: D. Da sind Sie nicht so eitel, einen in Verwunderung bringen zu wollen, sondern Sie deuten nur hin.” (GA 279, in: Ernst Moll (1897 — 1962), die Sprache der Laute, S. 93) Die deutschen Demonstrativpronomen ‘der’, ‘die’, ‘das’ ‘dieser’, ‘dort’ beginnen mit diesem hinweisenden D. Im Griechischen lautet der ‘Finger’, mit D an, ‘dáktylos’ und betont seine zeigende Funktion, ebenso ‘digitus’ bei den Römern. Mit ‘dirigere’ meinten sie, etwas auf ein Ziel hin zu ‘lenken, richten, wenden’, wovon ‘direkt’, ‘Direktor’ und ‘Dirigent’ kommt. Lateinisch ‘dicere’ bedeutet ’sagen’ und ‘zeigen, weisen, festsetzen, bestimmen’. Es ist enthalten in ‘Jus-dicere’, ‘das Recht weisen’, ‘judicare’, ‘richten’, ‘iudicum’, ‘Gericht, Untersuchung’ und ‘iudicatio’, ‘Urteil’. Ebenso wird die Richtung gewiesen bei ‘ducere’, ‘führen, leiten’ und ‘docere’, Unterricht. Ersteres, ‘ducere’, findet sich in ‘exducere’, woraus ‘educere’ wurde, ‘ziehend bilden, erziehen’. Zu ‘docere’ gehört ‘dóctrina’, ‘Unterweisung’, ‘dóctor’, ‘Lehrer’ und ‘documéntum’, ‘Lehre, Beispiel’. Im Griechischen heißt ‘zeigen’ ‘deiknýnai’, gotisch ‘ga-teihan’ und kommt von altindisch ‘disáti’. Keltisch heißt ‘zeigen’ ‘diskoein’.
Der Jünger Thomas, der seinen Finger in die Wundmale des Auferstandenen legen musste, um zu glauben, trägt den Beinamen Didymos, der Zwilling.
Das Hindeuten war nach Rudolf Steiner die Aufgabe des orientalischen Erziehers. Er war sozusagen Stellvertreter der Götter bzw. wurden die Götter als die eigentlichen Erzieher der Menschen angesehen. “Der orientalische Erzieher ist ja etwas ganz anderes als der europäische Erzieher. … der orientalische Mensch fühlt, dass der Erzieher derjenige ist, der einen auf alle Dinge hinweist, der einen immer aufmerksam macht; das ist das, das ist das, das ist das. Der lässt einen sonst ungeschoren, weil der Orientale annimmt, dass man sich aus sich selbst entwickelt. … nur hingewiesen wird man auf alles. Daher ist der orientalische Erzieher derjenige, der eigentlich in alledem, was er tut, immer ‘da’ sagt, da, da = Dada. So heißt er auch, Dada ist der orientalische Erzieher. Er ist derjenige, der einem alle Dinge zeigt: da, da!” (GA 279 in, Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 94)
Im gotischen Alphabet wird der D‑Laut ‘Daaz’ genannt, was abgeleitet ist vom gotischen Wort ‘dags’ der ‘Tag’. Bei den Angelsachsen ist der Name des D ‘Daeg’, ebenso der ‘Tag’. Der Runenreim lautet:
Tag ist des Herrn Bote — den Menschen teuer
das herrliche Gotteslicht; — Freude und Zuversicht
Reichen und Armen, — allen gedeihlich.
(Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 93)
Im Lateinischen ist mit ‘deus’ (Gott) ‘dies’ (Tag) verwandt. Rudolf Steiner weist auf diese Verwandtschaft hin: “Mit ‘dies = Tag’ hat man in älteren Zeiten die Wortverwandtschaft von ‘deus’ und ‘dies’ verbunden. Wenn man von Wochentagen sprach, so hat man nicht nur Zeiträume darunter verstanden, sondern man meinte die in Sonne, Mond, Mars wirkenden Wesensgruppen.” (GA 122 in, Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 95) Die Sonne, die bewirkt, dass es hell wird, die den Tag macht, wurde als höchste Gottheit verehrt. Rudolf Steiner sagt über diese Völker: “So hat man auch vielfach für diejenigen Völker, welche Sonnenanbeter wurden, … vorzugsweise darauf aufmerksam gemacht, dass sie den Tag bewirkte, den Tag machte. Und die Folge davon ist, dass viele Worte bei denjenigen Völkern, die im Wesentlichen die höchste göttliche Macht in der Sonne anbeten, für die Sonnenanbetung mit ‘Tag’ zu übersetzen sind” (GA 137 in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 95)
Der Tag, ‘dies’, ist also der große Erzieher und der deutende ‘Deus’, der lenkende Gott. Der strahlende Tag ist das D, der kosmische Deuter, der Hinweiser auf den göttlichen Willen. Annemarie Dubach Donath (1895 — 1972) zitiert Rudolf Steiner: “Das D ist der Laut, in dem nachgeahmt wird die ‘Reaktion auf ruhende Außenwelt’. — Der Mensch schaut sich um, gewahrt die Dinge der Welt um sich herum — ‘dies durch dich’ ist die Antwort seiner Seele auf das, was er wahrnimmt. Arme und Hände ‘deuten’ hin auf die Gegenstände, die draußen den Sinnen gegenüberstehen, senken sich hinein in die Umgebung, ‘er schwingt mit’.” (Die Grundelemente der Eurythmie, in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 95) Im Tag wurde also das lichtvolle, ausstrahlende Hindeuten des Gottes gesehen, damit der Mensch erkennen möge. Im klassischen Sanskrit heißt der ‘Lichtstrahl’ ‘didhiti’, in der älteren vedischen Sprache meint dieses Wort den geistigen Lichtstrahl der Andacht und Kontemplation, der Geisterkenntnis.
Auch das Wort ‘deutsch’ trägt diesen strahlenden, hindeutenden Charakter des D, denn ‘deut’ hängt mit gotisch ‘thiuda’, althochdeutsch ‘diot’, mittelhochdeutsch ‘diet’ zusammen und bedeutet ‘Volk’. Um das Jahr 1000 herum wird die deutsche Sprache ‘diutisco zungo’ genannt und ‘diuten’ heißt ‘deuten’. Damit ergibt sich für ‘deuten’ die Grundbedeutung ‘volkstümlich machen’. (Kluge, in Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 95) Worauf man deuten kann und was man deuten kann, ist also deutsch, wie die Redewendung ‘Sprich deutsch!’ noch heute suggeriert. Was klar und deutlich wird, bekommt Be-deutung.
In der Edda, der germanischen Mythologie, Schildert das Lied Fiölsvinsmal einen Einweihungsweg. Ein Jüngling, der Thursenfürst Windkald, also ‘Kalter Wind’, will die reine Jungfrau, Menglada, die ‘Sonnenglänzende’ gewinnen, die in der Waberlohe ihres Retters harrt. Als Swipdag, ‘Heller Tag’, ist ihr der Retter vorausgesagt und als solcher stellt sich der Held nach vielen Prüfungen ihr vor:
Auf reiß’ die Türe, schaff’ weiten Raum,
Hier magst du Swipdag schauen.
Doch frage zuvor, ob noch erfreut
Mengladen meine Minne. (Vers 43)
Und nach Mengladas Frage nach seiner Herkunft antwortet er:
Swipdag heiß ich, Solibart hieß mein Vater,
Her führten mich windkalte Wege.
Urddas Ausspruch ändert niemand,
Ob er unverdient auch träfe. (Vers 47)
Menglada antwortet:
Willkommen seist du, mein Wunsch erfüllt sich,
Den Gruß begleite der Kuss
Unversehenes Schauen beseligt doppelt
Wo rechte Liebe verlangt.
Lange saß ich auf liebem Berge
Dich erharrend Tag um Tag;
Nun geschieht was ich hoffte, da du heimgekehrt bist,
Süßer Freund in meinen Saal.
Swipdag sagt:
Sehnlich Verlangen hatt’ ich nach deiner Liebe
Und du nach meiner Minne.
Nun ist gewiss, wir beide werden
Miteinander ewig leben. (Verse 48, 49, 50)
(in: Gundula Jäger, Die Bildsprache der Edda, S. 392f)
Minne hängt zusammen mit englisch ‘mind’, mit Bewusstsein, Denken und Erinnern. Der Jüngling ist ein Thursenfürst, ein Fürst der trocknen Kräfte des Astralleibs, der Bewusstseinskräfte (im unterschied zu den Jotunen, den im Ätherleib wirkenden Kräften Lebenskräften). Diese Denkkräfte musste er schulen und wandeln. Er musste sich selber von Windkald, von einem windig, unbeständig und kalt denkenden Menschen zu Swipdag wandeln, zu einem Menschen mit lichtem Denken, das unbeirrbar seiner Spur folgt, gleich der Sonne am Himmel. Und er musste Minne entwickeln, die aus dem Bewusstsein und Denken geborene Liebe. Menglada verkörpert dagegen die aus dem Herzen strahlende Liebe.
Rudolf Steiner sagt über diesen Prozess: “Das Sonnenhafte, das der Mensch durch lange Zeiten nur aus dem Kosmos aufnahm, wird im Innern der Seele leuchtend werden. Der Mensch wird von einer inneren Sonne sprechen lernen … er wird das … eigene Wesen als sonnengeführt erkennen.” (GA 26 in: Gundula Jäger, Die Bildsprache der Edda, S. 392f)
Im ‘Du’ deutet der Mensch auf den Anderen und erkennt ihn als Gegenüber, als von sich verschieden und doch gleichermaßen Ichbegabt. Martin Buber sagt: „Der Mensch wird erst am Du zum Ich.“ (Buber, Ich und Du, 2005, S. 28)
Ein weiterer Aspekt gehört zum D. Mit dem hinstrahlenden Deuten wird bewirkt, dass das Gesehene konkret und ‘detailliert’ erkannt werden kann. Dadurch gehört zum D auch das ‘Determinierende’, Begrenzende, Festlegende. , wie es im Wort ‘Datum’ erlebbar wird. Was gesehen und darauf gedeutet werden kann, dass ist ein ‘Ding’, dessen Ursprungsbedeutung ‘Gericht’ ist, wie es noch der Thing-Platz, die Gerichtsstätte zeigt, mit der das Wort Ding verwandt ist. Das D ist auch das Richtungsgebende. “Das D drückt immer aus ein Feststellen, ein Richtiges.” (GA 282, in Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 102)
Der griechische Buchstabe Delta ist ein Dreieck. Dies ist auch die Form eines spitzen Dachs, welches das Haus nach oben abschließt und gleichzeitig zum Himmel weist. Schon die ältesten griechischen und phönizischen Inschriften zeigen diesen Buchstaben als Dreieck. Der Name Delta stammt vom hebräischen Buchstabennamen ‘Daleth’, was ‘Tür’ bedeutet, was einen weiteren Aspekt des D zeigt. Rudolf Steiner sagt über diesen Aspekt des D: “Immer ist die Tür etwas, das uns aufmerksam machen kann, dass da etwas ist. Und während der Mensch etwa im B noch ‘eingehüllt’, verborgen wie in einem Mantel im Schoße der Gottheit ruht — und zugleich gewahr wird das Andere, …’ wird der Mensch im D‑Laut stark, er dringt durch und findet sich selbst: <Ich muss durch>’.” (Dubach-Donath, Die Grundelemente der Eurythmie, in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 101) Als gleichschenkliges Dreieck ist es das umfassende Symbol für alles Hindurchstrahlen und Deuten. So wurde es zum göttlichen Auge. Rudolf Steiner sagt: “Das gleichseitige Dreieck mit dem Mittelpunkt ist das Symbolum für das equilibrierte Zusammenwirken von Denken, Fühlen und Wollen, aus dem heraus die Liebeskraft vom Menschen aktiv erzeugt werden soll. … Die Mission der Erdenentwicklung ist, ein vollständiges Gleichgewicht der drei Elemente des Denkens, Fühlens und Wollens zu bewirken. In der okkulten Symbolik wurde das stets durch das gleichseitige Dreieck ausgedrückt, mit dem Mittelpunkt, dem Ich, das dieses Gleichgewicht aktiv schafft und dadurch das vierte, das Element der Liebe schafft. … Die Dreiheit zur Vierheit machen, ist das Geheimnis der Erdenentwicklung.” (GA 212, in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 99f) Das D als Delta-Dreieck deutet also auch immer auf das Erdenziel hin, auf die zu entwickelnden höheren Wesensglieder des Geistselbst, Lebensgeist und Geistmenschen, für die das Symbol des Dreiecks ebenso steht. Diese Wesensglieder spielen für das ‘Denken’, das im Deutschen bedeutsamer Weise das Siegel des D trägt, eine entscheidende Rolle, wie Rudolf Steiner sagt: “Das Denken und Vorstellen wird nicht durch das Gehirn hervorgerufen, sondern ist eine innere übersinnliche Tätigkeit der drei höheren Glieder der menschlichen Wesenheit. Die Gedanken werden gespiegelt durch die Tätigkeit des Gehirns und wiederum zurückgeworfen in den Ätherleib, Astralleib und das Ich” (GA 129, in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 100)
So wie die Zähne, als das Festeste im Körper geordnet und gegründet stehen, so bildet der hinter den Zähnen gebildete Zahnlaut D die Kraft ab, sich durch das Denken geistig zu begründen — geistig da zu sein. Rudolf Steiner sagt: “Das Kind hat noch mit den physischen Zähnen gedacht. … Dann emanzipiert sich die Wachstumskraft der Zähne und wird Denkkraft im Menschen, selbständige, freie Denkkraft. … [Dann werden die Zähne] Helfer für dasjenige, was die Gedanken durchdringt, für die Sprache. … Im Haupte emanzipiert sich die Zahnwachskraft als Denkkraft: dann wird gewissermaßen hinuntergeschoben dasjenige, was die Zähne jetzt nicht mehr direkt zu besorgen haben … ins Sprechen, sodass die Zähne Helfer werden beim Sprechen; darin zeigt sich noch ihre Verwandtschaft mit dem Denken. Verstehen wir, wie die Zahnlaute sich in das ganze Denken des Menschen hineinstellen, wie da die Zähne zu Hilfe genommen werden gerade dann, wenn der Mensch durch D T das bestimmte Denkerische, das definitive Denkerische in die Sprache hineinbringt: dann sehen wir an den Zahnlauten noch diese besondere Aufgabe der Zähne. … Wir haben nicht mehr ein bloß Physisches im Menschen, das Beißen der Zähne, oder höchstens das sich Bewegen beim Sprechen bei den Zahnlauten, sondern wir haben in den Zähnen ein äußeres Bild, eine naturhafte Imagination des Denkens. Das Denken schießt gewissermaßen hin und zeigt sich uns an den Zähnen: Seht Ihr, da habt Ihr meine äußere Physiognomie!” (GA 307 in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 106)
Wird der Mund aufgesperrt, so bilden die beiden Zahnreihen des Ober- und Unterkiefers ein Oval. Wird in dieses Oval in “Kreis”-segmente, z.B. nach der Anzahl der Wochen im Jahr geteilt, entstehen spitze Winkel, fast Delta-Formen. Denke ich mir diese sich im Zentrum treffenden Dreiecke am Rand des Ovals aufgestellt, so entsteht das Bild von Zähnen. Allerdings haben wir weniger Zähne, als Wochen in einem Halbjahr sind.
Der Zahn ist das D: altirisch ‘det’, litauisch ‘dantis’, lateinisch ‘dens, dentis’ griechisch ‘odús, odóntos’, altindisch ‘dant, danta’. Das D ‘dividiert’.
Im Keltischen sind die Namen des D irisch ‘dair’ und schottisch-gälisch ‘duir’, beide mit der Bedeutung ‘Eiche’. Das D wird hervorgebracht, sagt Rudolf Steiner “dass sich der ganze Mensch mit allen seinen vier Gliedern einen Schwerpunkt schafft. (GA 162 in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 105) Dieser Schwerpunkt ist verschieden beim D, T und Th: beim D liegt er im Astralischen, beim T im Ätherischen und beim Th im physischen. Von der Eiche, ‘dair’ haben die ‘Druiden’, die geistigen Führer der Kelten ihren Namen.
Der slawische Name des D ist ‘dobró’, das ‘Gute’. Etymologisch stammt es von ‘dóba’, dessen Grundbedeutung ‘Zeit, Zeitpunkt, Termin’ ist. Das Gute ist also das in der Zeit Festgesetzte. Altbulgarisch bedeutet ‘po-dobá-jet’, wie auch griechisch ‘dei’, ‘es ist nötig, es geziemt’ und meint das zu einem bestimmten Zeitpunkt Richtige und Gute, das zu tun ist. Slawisch ‘délo’ ist die ‘Tat’ von ‘délati’, ‘tun’, abgeleitet von altindisch ‘dádhati’, ’setzen’. Der Stern hieß bei den alten Slawen ‘dsvesda’, der vom Himmel aus deutet und den Weg weist.
Über die Gegensprüche 4 D und 30 d
Das Licht prägt die Stimmung der Mantren 4 D und 30 d, ohne dass es im Zentrum steht. Diese Mantren sind hell, sehr hell sogar. Inneres Licht wird gerne mit Bewusstsein verbunden. Doch das Mantra 4 D hat nur bedingt einen wachen Ich-Sprecher. Es ist die Empfindung, die nicht die Umwelt, sondern sich selbst wahrnimmt, sich selbst fühlt und dies ausdrückt. Doch alles weitere ist in der neutral beschreibenden dritten Person verfasst. Es geht um einen Prozess, der auch dann — oder sogar gerade dann geschieht, wenn kein waches Tagesbewusstsein herrscht. Im Mantra 30 d ist das anders, denn dieses Mantra ist aus der Perspektive eines Ich-Sprechers geschrieben. Auch sein Blick richtet sich nach innen. Er benennt die Ergebnisse seines Denkens, die Veränderung seines Fühlens und schließlich das, was er empfindet. Neben dem Licht (4 D: sonnerhellte Welt, Lichtesfluten und 30 d: Seelensonnenlicht, Seelensommer) spielt in beiden Mantren die Empfindung bzw. das Empfinden eine Rolle.
Im Mantra 4 D spricht die Empfindung. Sie sagt, dass sie das Wesen ihres Wesens fühlt. Die Empfindung ist das erwachende Bewusstsein, die aufkeimende Wahrnehmungsfähigkeit. Ich verstehe die Empfindung als das, was Rudolf Steiner die Empfindungsseele nennt. Diese Seele kennzeichnet ein Bewusstsein, das noch eine Einheit bildet mit dem Wahrnehmungsgegenstand, mit der Welt. Die Empfindung sagt und erkennt damit, dass sie sich selber wahrnimmt. Sie fühlt das Wesen ihres Wesens. Sie sagt, dass sie das selber fühlt: “Ich fühle …” Die Empfindung spricht als Ich, denn das aufkeimende Bewusstsein, das mit zunehmender Wachheit zum Ich-Bewusstsein werden wird, nimmt zuerst die eigene Empfindungsfähigkeit und dadurch sich selber wahr. Die Empfindung nimmt wahr, dass Ihr Wesen fühlendes Gewahrsein ist.
Was nun folgt, nimmt die Empfindung nicht selber wahr. Es wird als ein objektiver Vorgang geschildert. Die Empfindung ist in einer Umgebung, in einer Welt, die von der Sonne erhellt ist. Diese Sonne könnte das eigene Bewusstseinslicht sein, denn ohne dieses Licht ist die Empfindung nicht in der Lage überhaupt etwas wahrzunehmen. Doch die Empfindung erkennt es nicht als Eigenlicht. Sie vereint sich mit den Lichtesfluten, mit der auf sie einströmenden, ununterbrochenen Flut an Wahrnehmungen. In jeder Wahrnehmung ist Licht verborgen, Weisheitslicht durch das dieses Wesen oder dieses Ding geschaffen wurde. Die Weisheit einer Pflanze sind z.B. die geometrischen Gesetze, sichtbar in der Anordung der Blütenblätter, die Weisheit des Photosynteseprozesses usw. Auch wenn diese Weisheit dem Betrachter nicht bewusst wird, ist sie in der Wahrnehmung enthalten. Die Empfindungsseele vereinigt sich mit diesen Weisheits-Lichtesfluten der Wahrnehmung. Und gerade aus der wahrnehmenden Vereinigung mit der Welt kann die Empfindungsseele die Wärme gewinnen, die sie dem Denken zu dessen Klarheit schenken will. Für die Empfindungsseele gibt es noch keine Dualität. Sie erlebt ungebrochene Einheit mit der Welt, denn die Trennung kommt erst in der Verstandes- oder Gemütsseele, die sich getrennt und der Welt gegenüberstehend erlebt. Durch ihr Sein verbindet die Empfindungsseele den Menschen fortwährend mit der Welt, auch wenn dieses Einheitsbewusstsein vom Verstand übertönt wird.
Im Mantra 30 d stellt der Ich-Sprecher fest, dass ihm im Seelensonnenlicht reife Früchte des Denkens wachsen. Sie sprießen ihm in Sonnenlicht seiner Seele. Dieses Seelensonnenlicht ist das Seelenlicht, die zu Bewusstsein sich wandelnde Lebenskraft, die jede Seelenfähigkeit und so auch das Denken erst ermöglicht. Reife Denkfrüchte sind Ideen, Gedankenzusammenhänge, die lebendig gewachsen und an der Wirklichkeit sich gebildet haben. Diese tragfähigen Denk-Früchte verwandeln das situative, schwankende Fühlen in die Sicherheit des Selbstbewusstseins. Die wichtigste Denk-Frucht ist die Erkenntnis von sich selbst, die Selbsterkenntnis. Echte Selbsterkenntnis bewirkt sicheres Selbstbewusstsein. Und durch die Sicherheit des Bewusstseins von sich selbst, begründet der Mensch sich als Geist. Der Geist, der im unbewussten Zustand geschlafen hatte, erwacht. Rudolf Steiner sagt, dass die Erde im Herbst erwacht, indem sie alle Lebenskräfte in sich hineinzieht. Zum Herbst gehört also das Erwachen des Geistes. Und das ist erst der Anfang, denn die Wachheit steigert sich bis in den Winter — und mit ihr das Seelensonnenlicht, denn das wird im Seelensommer sicherlich besonders hell und warm scheinen.
Im Mantra 4 D wird die hinstrahlende, hinweisende, die Welt berührende Qualität des D’s erlebbar. Im Mantra 30 d berührt die Welt den Menschen. Diese Berührung zeigt sich in den sprießenden Denk-Früchten und im Sicherwerden des Selbstbewusstseins. Hier steht die befestigende Qualität des Stoßlautes im Vordergrund.
Im Mantra 4 D kann die Liebe der Menglada, der Sonnenglänzenden, gesehen werden, im Mantra 30 d die Minne, die Bewusstseinskraft, von Swipdag, Heller Tag. Und vielleicht ist die klangliche Ähnlichkeit von Menglada und Magdalena kein Zufall, bestätigt Rudolf Steiner doch, dass das Gewandt der Maria Magdalena gelb dargestellt wurde. “Die Magdalena werden Sie sehr häufig bei denen, die die Tradition gut gekannt haben oder noch etwas Hellsehen gehabt haben, im gelben Gewand sehen … Da ist immer versucht worden, zu entsprechen der Aura der betreffenden Individualität; denn das Bewußtsein war vorhanden, in der Kleidung die Aura nachzuahmen, in der Kleidung einen Ausdruck der Aura zu schaffen.“ (Lit.: GA 163, S. 36f)